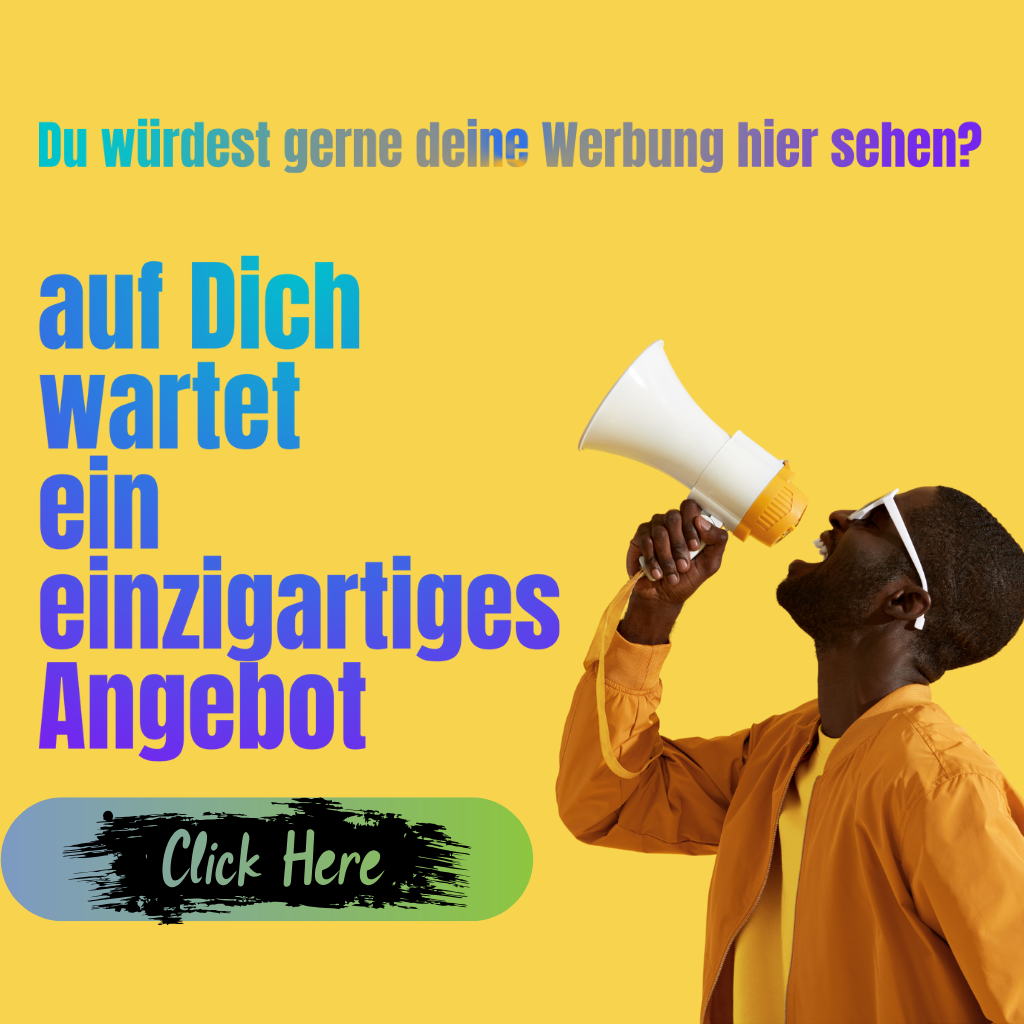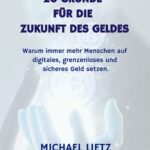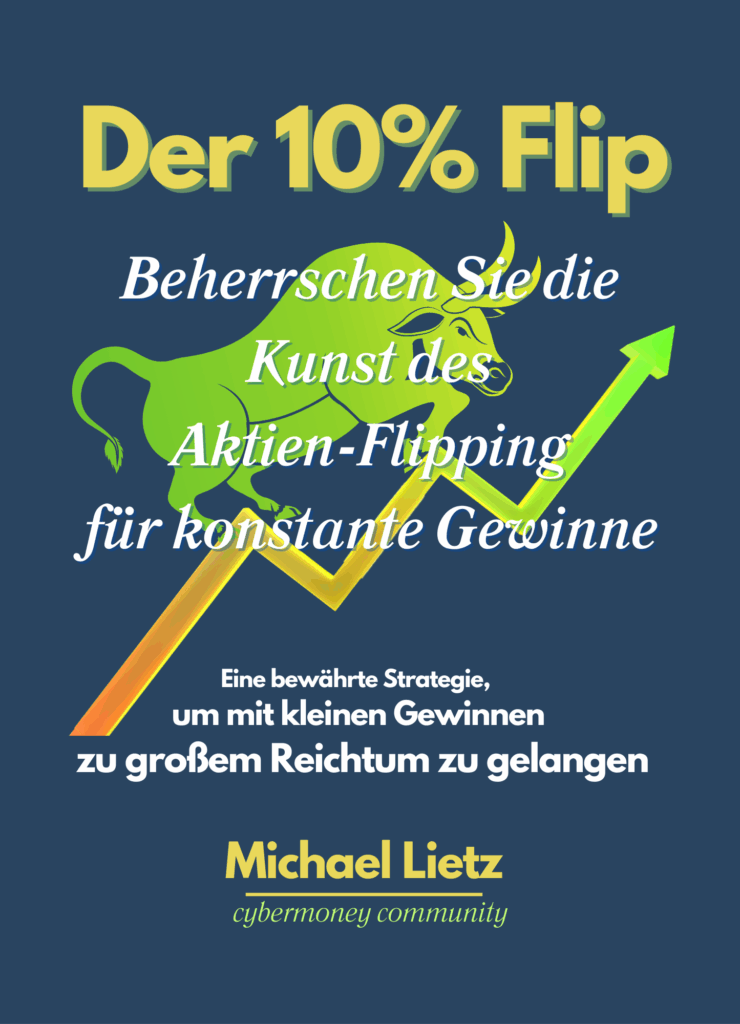In einem grünen Hügelland, unweit der Altstadt von Nördlingen, erhebt sich ein stummer Zeuge einer dunklen Vergangenheit: der sogenannte Hexenfelsen auf dem Galgenberg, heute eingebettet in den sanften Landschaftspark der Marienhöhe. Einst war dieser Ort kein idyllischer Aussichtspunkt, sondern die Bühne für Schrecken und Schmerz – ein Platz, von dem Feuerturm und Henkerlisten das ganze Ries in ein fahles Licht tauchten. Hier brannten zwischen 1589 und 1598 insgesamt 34 Frauen und ein Mann auf Scheiterhaufen, in großer Sichtweite, als Warnung und Ausdruck puren, kollektiven Aberglaubens.
Die Verfolgung begann 1589, als die Stadt unter ihrem Bürgermeister Johannes Pferinger, fest entschlossen zur „Säuberung“, dem Aberglauben religiöse Legitimation gab. Mit dem Auftreten von Ursula Haider, die öffentlich vom Pakt mit dem Teufel sprach und andere belastete, entfaltete sich eine Spirale der Denunziationen. Namen fielen, Vorwürfe wuchsen, Gerüchte wurden zu verbotenen Geständnissen. Wer einmal angeklagt war, stand kaum noch in eigener Hand. Maria Marb, Margarethe Getzler, Anna Seng, Rebekka Lemp – Frauen aus unterschiedlichen Schichten, vom einfachen Stand bis zur angesehenen Hausherrin, fanden sich in Kerkern und auf dem Weg zur Richtstätte wieder.
jetzt in Aktien investieren – lerne es mit dem Buch!
Die Methoden waren grausam kalkuliert. Folter wurde zur Regel, peinliche Vernehmungen zur Todesverpflichtung. Daumenschrauben, spanische Stiefel, Streckbänke – Instrumente menschlicher Erfindungskraft, benutzt zur Ausbeutung der Wahrheit. Inhaftierte klagten über Hunger, überbrummte Nächte, Zerfall in Geist und Körper. Einige starben in der Haft, andere brachen unter dem System zusammen. Eine, die sich dem Druck widersetzte, war Rebekka Lemp, deren Geschichte stellvertretend für viele steht: Widerrufe, erzwungene Geständnisse, öffentliche Demütigung. Am Ende aber war auch sie Opfer einer Maschinerie, die keine Rücksicht kannte.
Eine Stimme erhob sich inmitten des Wahns: Wilhelm Friedrich Lutz, der Superintendent der Stadt. Mit Predigten voller Wut und Schmerz warb er für Mäßigung, für Gerechtigkeit. Doch sein Protest verhallte im Rat der Stadt, wo Ratsherren, Advokaten und der Bürgermeister selbst den Verfolgungsgeist nährten. Erst als ein prominentes Opfer widerstand – die Metzgerwitwe Maria Holl, eine angesehene Wirtin, gehorsam und furchtlos – begann die Gewalt des Rates zu brechen. Nach 62 peinlichen Verhören blieb sie standhaft, wurde freigelassen und unter Auflagen gezwungen, ihr Haus nicht zu verlassen. Ihr Beharren war ein Wendepunkt, der die blutigste Welle beendete, bevor sie die Stadt weiter entstellte.
Und so wurden auf dem kahlen Galgenberg Flammen entzündet, als sei Nördlingen selbst entflammt. Die Feuer brannten weithin sichtbar, und ihre Flammen waren Botschaft und Drohung zugleich. Doch heute, unter dem Blätterdach der Marienhöhe und umgeben von Wanderwegen, Vogelgesang und dem Duft der Linden, wirkt der Ort still, fast sanft. Nur der graue Block des Hexenfelsens bleibt, massiv und kalt, als Erinnerung an jene Tage, in denen der Glaube stärker war als das Leben.
Der Felsen selbst ist kein Zufall – er steht auf kristallinem Grundgestein, emporgehoben durch den Meteoriteneinschlag, geformt durch Jahrtausende als Dolomitklotz mitten in der Natur. Ein geologisches Kunstwerk, sichtbar, majestätisch – heute als Naturdenkmal geschützt. Einst jedoch diente er als Bühne der Angst. Heute ist er Anziehungspunkt für Wanderer, für Familien auf dem Schäferweg, für alle, die Geschichte begreifen wollen – nicht als trockene Statistik, sondern als Zeugnis menschlicher Fehlbarkeit.
Viele besuchen heute die Marienhöhe, spazieren durch den Landschaftspark, sehen Kinder auf Spielplätzen lachen oder beobachten Jogger und Naturliebhaber auf dem Weg zum Adlersberg. Der Hexenfelsen liegt am Rande dieser Idylle, still, verwittert und doch eindringlich: ein Denkmal für Gerechtigkeit, die versagte; für Leid, das niemals vergessen werden darf. Wer hier verweilt, hört den Lärm der Flammen nicht, aber spürt die Stille hinter ihnen. Und er fragt sich: Wie kann Glaube zur Waffe werden? Wie kann Ordnung Menschen zerstören?
Am Ende bleibt der Hexenfelsen mehr als nur ein geologisches Ausflugsziel. Er ist ein Mahnmal – gegen Aberglauben, gegen Willkür, für Erinnerung. Und vielleicht die leise Hoffnung, dass in dieser Stadt, in diesem Ries, das Leben mehr zählt als der Irrglaube, dass Menschen Macht haben über andere, nur weil Furcht ihnen folgt.